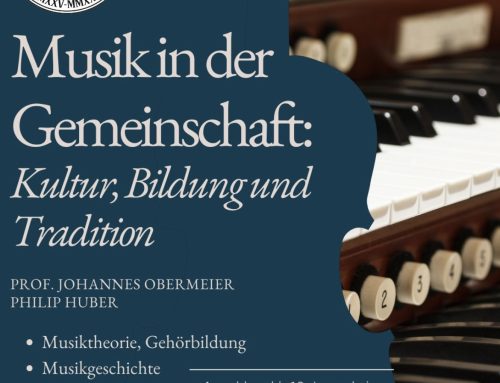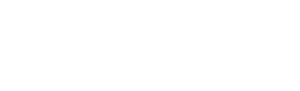Die 42. CV-Medientage in Banz: KI wird Alltag
Auf Kloster Banz diskutierten Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Bildung, wie Künstliche Intelligenz unseren Alltag verändert – und wo Grenzen, Risiken und Regulierung nötig sind.
Die 42. CV-Medientage fanden traditionell im Bildungszentrum Kloster Banz der Hanns-Seidel-Stiftung statt und widmeten sich dem Thema: „Künstliche Intelligenz – aus Science-Fiction wird Realität“. Im Mittelpunkt stand, wie KI bereits heute Alltag, Arbeitswelt, Forschung, Bildung, Politik und Verwaltung prägt. Diskutiert wurden Chancen – etwa breiterer Zugang zu Wissen und Dienstleistungen – ebenso wie Risiken von Manipulation, Kontrollverlust und der wachsende Bedarf an wirksamer Regulierung. Hochkarätige Referentinnen und Referenten beleuchteten das Thema in Vorträgen und Diskussionsrunden. moderiert wurde die Veranstaltung von Hans-Jürgen Fuchs (Fd) und Heinrich Wullhorst (S-T).








Auftakt: Praxisfokus Wirtschaft – Peter Wilfahrt
Zum Auftakt zeigte Peter Wilfahrt, Chief Digital Officer der IHK Oberfranken, wie stark KI Unternehmensprozesse beeinflusst – von der Medizintechnik bis zur Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft. Seine These: „KI bietet die Möglichkeit, alles, was wichtig ist, besser zu machen.“ Ergebnisse dürfe man jedoch nicht blind übernehmen; es brauche stets kritische Prüfung und vor allem die Fähigkeit, gute Fragen an KI-Systeme zu stellen, um gute Antworten zu erhalten.

Ethik und Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Schwartz
„Die Künstliche Intelligenz ist strohdumm“ – mit dieser Zuspitzung machte Cartellbruder Prof. Dr. Thomas Schwartz (Wf), Wirtschaftsethiker und Hauptgeschäftsführer von Renovabis, deutlich: Ohne menschliche Daten, Ziele und Kontrolle bleibt KI funktionslos. Zugleich markiere KI einen tiefen Umbruch, vergleichbar mit früheren industriellen Revolutionen. Schon heute begleitet sie uns beim E-Mail-Filtern, bei personalisierten Produktempfehlungen oder der Energieoptimierung in Gebäuden und Städten.
Als zentrale Herausforderung nannte Schwartz die Kontrolle: Die Geschwindigkeit, mit der KI in kritische Geschäftsprozesse einzieht, übersteigt oft etablierte Mechanismen von Governance und Sicherheit. Risiken seien die Verstärkung sozialer Ungleichheiten durch unterschiedliche Teilhabechancen sowie das „Black-Box-Dilemma“, da interne Entscheidungswege komplexer Modelle selbst für Entwickler schwer nachvollziehbar sind. Im Mittelpunkt müsse die Verantwortung des Menschen stehen. Positiv bewertete er den EU AI Act als starkes Fundament, das Vertrauen, Akzeptanz und Innovation „made in Europe“ fördert.

Politik & Verwaltung im Wandel: Prof. Markus Kaiser
Per Zoom zugeschaltet skizzierte Prof. Markus Kaiser (Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm) den Einsatz von KI in Politik und Verwaltung: von Stimmanalysen und datenbasierter Politikberatung über Frühwarnsysteme für Trends bis zu produktiven Workflows in Behörden. Für den bayerischen Kommunalwahlkampf im Frühjahr 2026 erwartet er wachsende Bedeutung KI-gestützter Anwendungen. Historisch ordnete er KI ein – von symbolischen Ansätzen der 1950er über „AI-Winter“ bis zum Durchbruch durch Deep Learning (2012) und die Transformer-Architektur (seit 2017).
Zentrale Aufgabe bleibe die Erkennung von Falschinformationen und Deepfakes; zugleich ermögliche KI wirkungsvolle Filter gegen Hate Speech. In den Medien entstünden bereits KI-gestützte Formate, etwa virtuelle Moderatorinnen und Moderatoren. Als gutes Beispiel für die öffentliche Hand nannte er die KI-Strategie der Stadt Wien.
Fundament legen: Prof. Melanie Kaiser über KI-Studium in Ingolstadt
Prof. Melanie Kaiser (TH Ingolstadt) leitet den Studiengang „Künstliche Intelligenz“, ist in der Wirtschaftsinformatik verortet und vertritt in der Lehre Datenmanagement- und Datenanalysesysteme – die Grundlage, um Daten hochwertig zu erfassen, zu strukturieren und für KI-Modelle nutzbar zu machen. „Es geht im Studiengang nicht darum, zu lernen, wie man ChatGPT bedient“, betonte sie.
Der Bachelor „Künstliche Intelligenz“ vermittelt mathematisch-statistische Grundlagen, Programmierung, Machine Learning sowie Bild- und Spracherkennung bis hin zu Big-Data-Technologien – mit dem Ziel, lernende Systeme zu konzipieren, zu trainieren und verlässlich zu betreiben. Darauf baut der forschungsnahe Master „Artificial Intelligence“ auf. Klar benannte Kaiser auch die Hürde: In den ersten Semestern sorgen Mathematik und Statistik für eine spürbare Abbrecherquote.

Schule & Unterricht: Kai Wörner über KI-Kompetenzen
Kai Wörner vom Studienseminar der Realschule am Europakanal in Erlangen bildet Lehramtsanwärterinnen und -anwärter aus und treibt die Digitalisierung der Seminarausbildung mit „DiBiS – Digitale Bildung im Seminar“ voran. Er schilderte die frühen Lernkurven: „Wir haben sicher tausend Fehler gemacht – aber aus ihnen gelernt.“
Sein Befund: Digitalisierung reduziert Kommunikation nicht, sie verändert sie – und eröffnet oft intensivere Interaktionen mit Schülerinnen und Schülern. Mit KI verschiebt sich der Fokus etwa bei Hausarbeiten: Bewertet werden weniger Endprodukte als vielmehr die Fähigkeit, gute Prompts zu formulieren, Quellen kritisch zu prüfen und tragfähige KI-Strategien zu entwickeln. Auch Lehrkräfte profitieren, etwa bei Vorbereitung und Durchführung von Unterrichtseinheiten.

Banz-Moment: Inhalte, Begegnungen, Netzwerk
Am Ende zeigten sich die Teilnehmenden begeistert von der inhaltlichen Dichte – und vom besonderen Banz-Flair: Die CV-Medientage leben nicht nur von Vorträgen, sondern ebenso von den vielen Gesprächen am Rande – etwa abends im Bierstübl. Wünschenswert wäre künftig eine stärkere Beteiligung der Aktivitates, damit die Debatten rund um KI noch breiter in die Verbindungen getragen werden.

Text und Fotos: Heinrich Wullhorst
Weitere Beiträge in dieser Kategorie